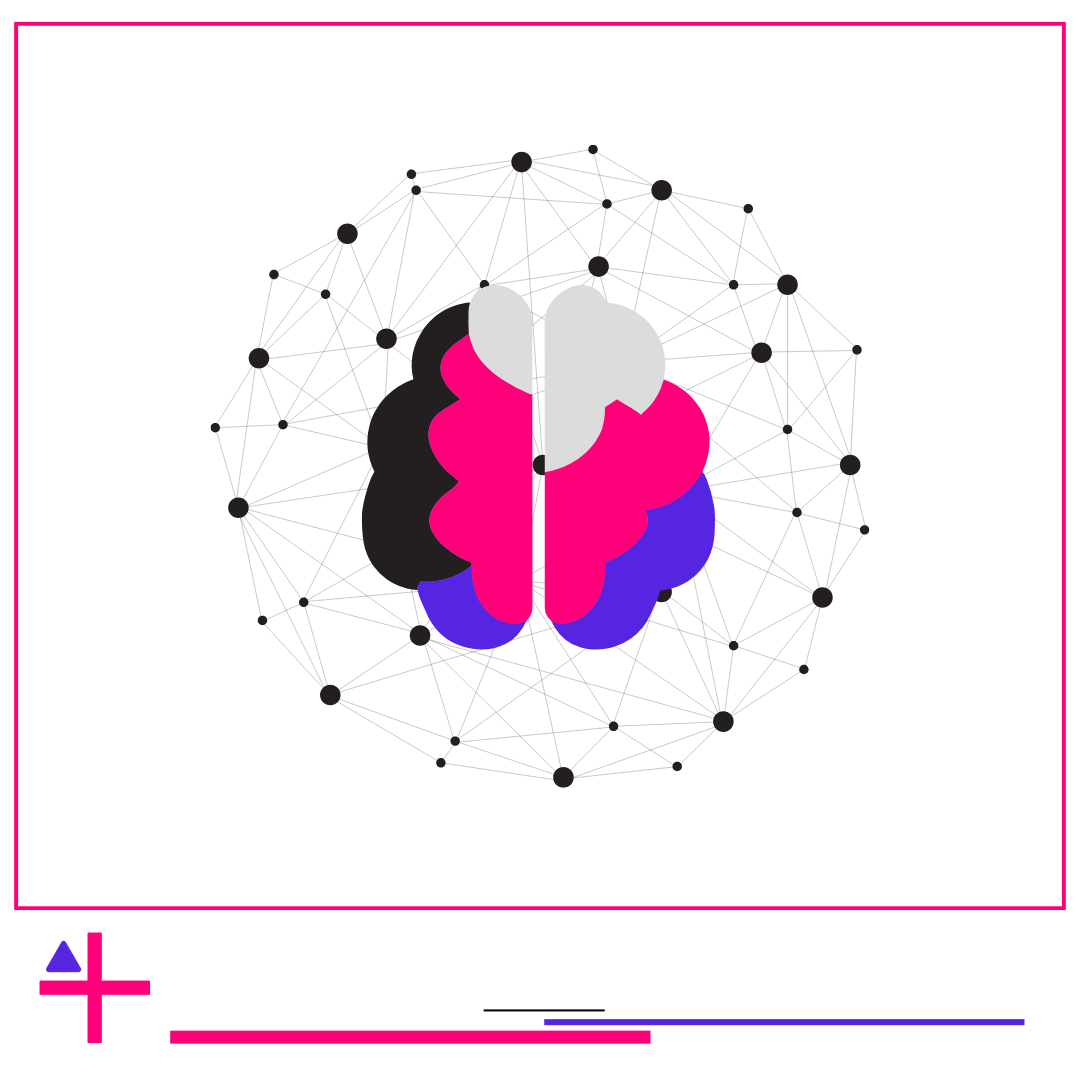
Neurodiversitätsnetzwerke sind in vielen Organisationen noch kaum sichtbar, dabei haben sie das Potenzial, zu echten Katalysatoren für Inklusion zu werden. Eine neue Studie von van Rijswijk et al. (2024) bietet erstmals tiefere Einblicke in die Dynamiken, Chancen und Paradoxien dieser Netzwerke und zeigt, warum sie oft an den unsichtbaren Hürden scheitern, die sie eigentlich abbauen wollen.
Was sind Neurodiversitätsnetzwerke?
Neurodiversitätsnetzwerke sind freiwillige, mitunter von Mitarbeitenden gegründete Gruppen, die sich für die Belange von neurodivergenten Beschäftigten einsetzen, also von Menschen mit Autismus, ADHS, Dyslexie und anderen neurologischen Besonderheiten.
Sie haben in der Regel zwei zentrale Ziele:
- Intern: Einen sicheren Raum schaffen, Austausch ermöglichen, Identität stärken.
- Extern: Sichtbarkeit fördern, Strukturen verändern, Organisationen für Neurodiversität sensibilisieren.
Was zeigt die Studie?
Die qualitative Studie basiert auf 18 Interviews mit Mitgliedern und Nichtmitgliedern aus fünf Neurodiversitätsnetzwerken. Die Ergebnisse machen deutlich: Die Netzwerke leisten viel , doch sie stehen vor strukturellen, sozialen und persönlichen Herausforderungen. Besonders spannend sind drei Paradoxien, die die Autor*innen herausarbeiten:
Drei zentrale Paradoxien
- Relationale Herausforderungen:
Die Netzwerke entstehen als Antwort auf Missverständnisse zwischen neurotypischen und neurodivergenten Personen und reproduzieren diese Konflikte oft intern. Unterschiedliche Bedarfe (z. B. von Autist*innen vs. ADHSler*innen) erschweren die Zusammenarbeit, besonders bei wachsender Verantwortung. - Support–Strain-Paradoxon:
Was als unterstützender Raum gedacht ist, kann selbst zur Belastung werden. Viele Netzwerke sind überlastet, weil Mitglieder zusätzlich zu ihrer Arbeit auch Netzwerke organisieren , oft ohne ausreichend Ressourcen oder Rückhalt. - Sichtbarkeit des Unsichtbaren:
Neurodivergenz ist oft nicht sichtbar. Netzwerke machen sie sichtbar, das kann empowern, aber auch zu Stigmatisierung oder (gefühltem) Outing führen. Für viele bleibt die Frage: Muss ich mich zeigen, um dazugehören zu dürfen?
Was heißt das für Unternehmen?
Die Studie zeigt klar:
Neurodiversitätsnetzwerke können Inklusion fördern aber nur, wenn Organisationen sie ernst nehmen, aktiv unterstützen und nicht instrumentalisieren.
Das bedeutet konkret:
- Klare Vereinbarungen über Rollen, Ressourcen und Einfluss
- Strukturelle Einbindung, ohne die Autonomie zu untergraben
- Psychologische Sicherheit für alle Beteiligten
- Interne Sensibilisierung auch bei HR, D&I und Management
Unser Fazit
Neurodiversitätsnetzwerke sind keine Feel-Good-Gruppen. Sie sind strategisch wichtige Akteure für Inklusion.
Doch sie brauchen Räume, Ressourcen – und Anerkennung.
Nur dann kann aus dem „unsichtbaren“ Engagement echte strukturelle Veränderung werden.
Quelle:
van Rijswijk, J., Curseu, P.L., & van Oortmerssen, L.A. (2024). The salience of the invisible: insights into the evolution, dynamics and relational challenges of employee neurodiversity networks. Employee Relations.
https://www.sciencedirect.com/org/science/article/pii/S0142545525000519

Tobias Tischmeyer
Co-Founder Differgy